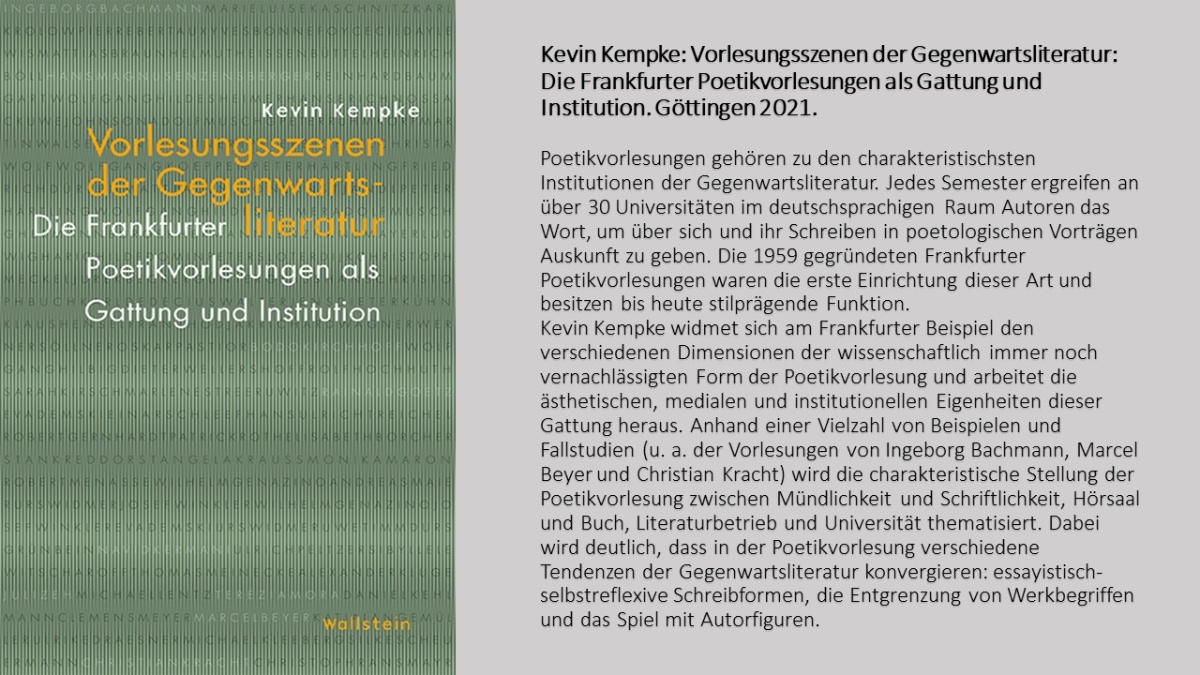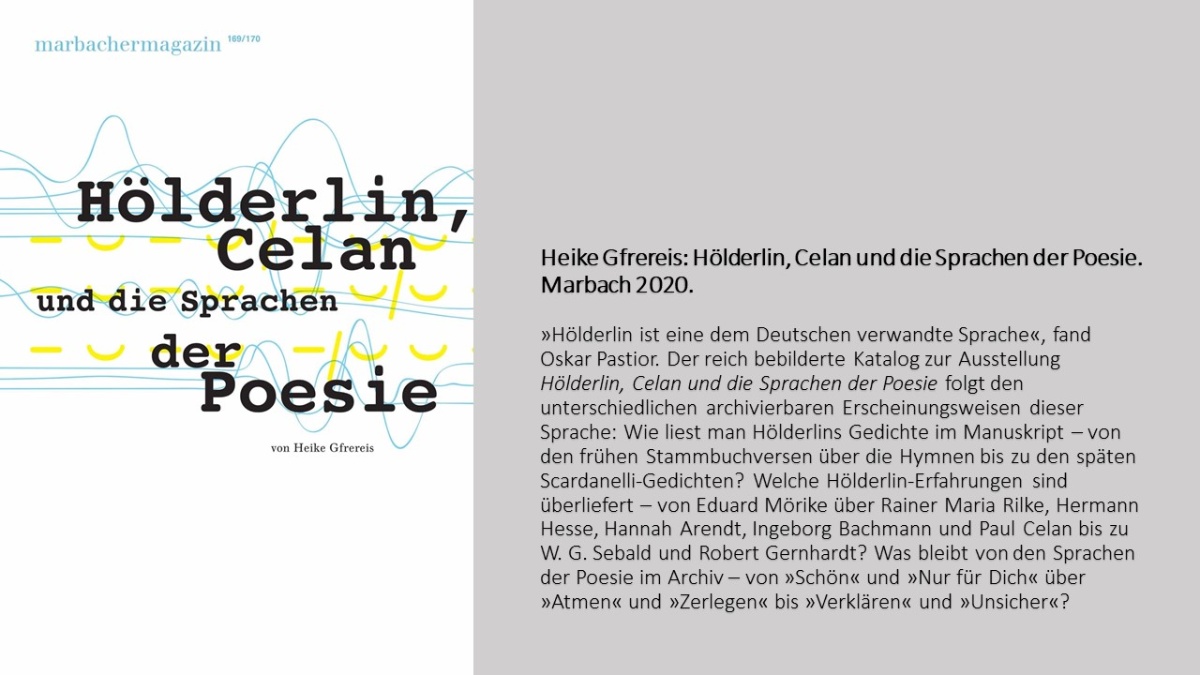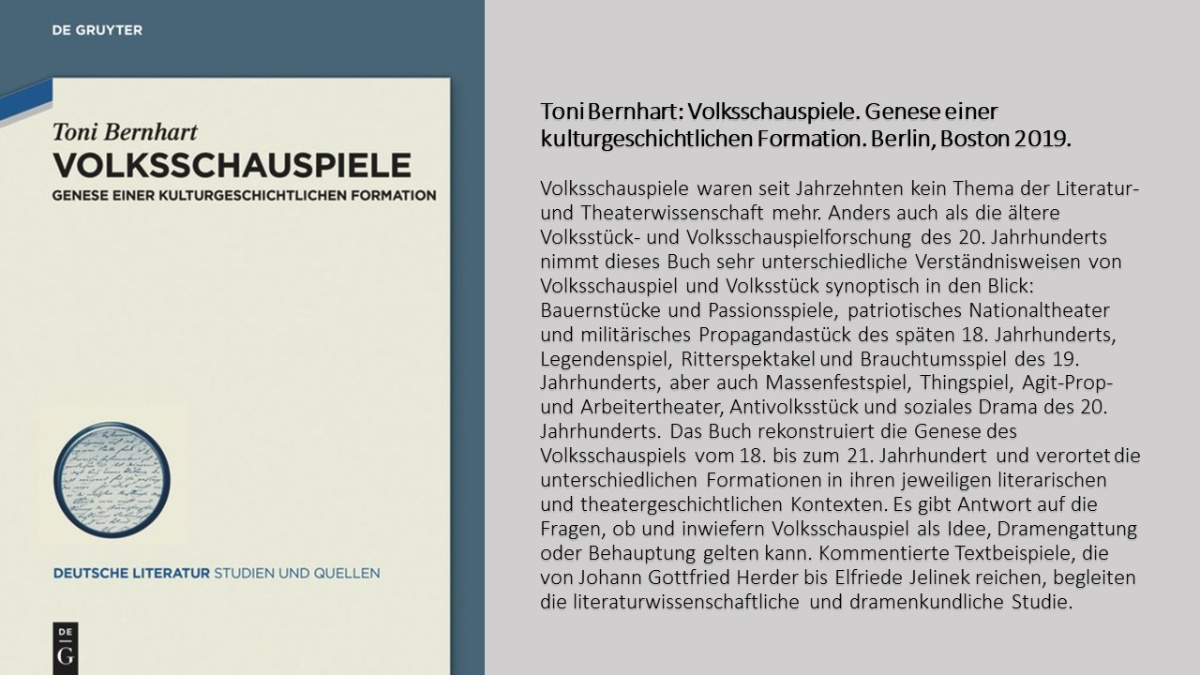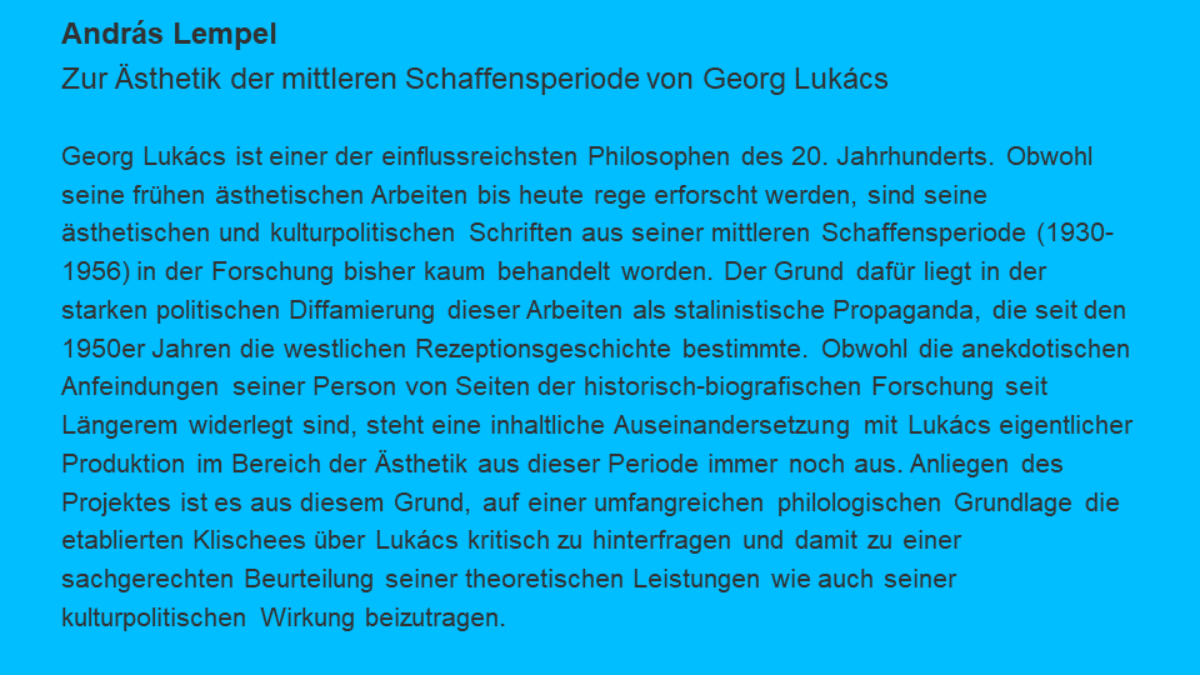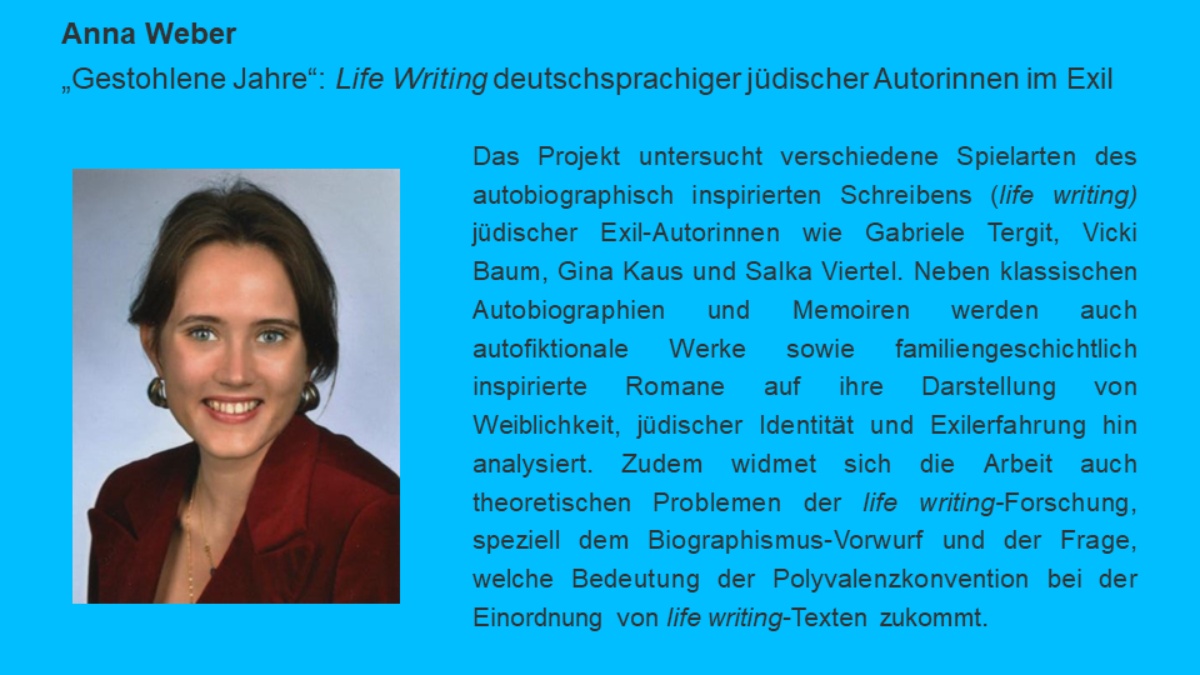Die Stuttgarter Neugermanistik zeichnet sich durch ihre Breite an Themen und methodischen Zugängen aus. Literaturgeschichtlich deckt sie die Literatur von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart ab und arbeitet unter anderem komparatistisch, kulturwissenschaftlich, interdisziplinär, rezeptionsorientiert, literatursoziologisch oder mit Methoden der Digital Humanties. Enge Kooperationen bestehen mit dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach und dem Stuttgart Research Centre for Text Studies. Näheres zu den jeweiligen Forschungsschwerpunkten der einzelnen Personen finden Sie auf deren Websites.
Jüngst erschienene Bücher
Tagungen, Workshops und Veranstaltungsreihen
In the new millennium internet access has increased considerably in African countries. Recently, the pandemic has led to a widespread use of videoconferencing technologies such as Zoom and increased the number of online streaming services. This has also influenced the way people use these media for theatre and in performances, both in person and online, including digital technologies. Digital technologies therefore may have an impact on the self-presentation of theatres in the way they reach their audiences, and how artists produce theatre, and research and rehearse. It also determines what kind of technology they use on stage, and how these technologies are used for effect. Collaborative projects that theatre groups and artists commit to are facilitated by these new technologies and may influence how they create new productions. New technologies also raise new questions with respect to the use of multilingualism in performances. Yet digital technologies might also enter fields such as applied performance and lead to new ways of production and distribution. Finally, the use of AI on stage might change performative interactions; its use along the production process, e.g. for the devising of scripts or project plans, might create new forms of standardization and needs to be inquired further.
The conference proposes to start a discussion on how digital technologies are used in contemporary African, Afrodiasporic and collaborative theatre and on how and if what is being produced is influenced by the use of these technologies. Which possibilities are opened up through the use of new technologies and which are the fields that are intentionally kept or keep out of the way of new technologies? How do aesthetics, accessibility and power shape productions and collaborations?
Veranstalter*innen:
Prof. Dr. Annette Bühler-Dietrich (Neuere Deutsche Literatur I)
PD Dr. Sven Thorsten Kilian (Romanische Literaturen)
Die Demokratie steht weltweit unter Druck; sie wird durch geopolitische Konkurrenten angegriffen und durch innenpolitische Feinde herausgefordert. An der Universität Stuttgart beginnt im Herbst 2024 ein Projekt, das die damit verknüpften Forschungsfragen in einem interdisziplinären Projekt zum Thema macht. Das im Rahmen des Wissens- und Technologietransfers geförderte Projekt sucht zugleich den Dialog mit der Öffentlichkeit. Renommierte Gäste wie Nora Bossong, Philip Manow und Maximilian Steinbeis werden bei verschiedenen Abendveranstaltungen ihre Analysen zur Diskussion stellen.
Das Thema der wehrhaften Demokratie wird aus geschichts-, literatur- und politikwissenschaftlicher Perspektive beleuchtet: Die Disziplinen werden durch Prof. Dr. Wolfram Pyta, Prof. Dr. Torsten Hoffmann und Prof Dr. Felix Heidenreich vertreten. „Die Kompetenz, politisch relevante Leitvokabeln zu dechiffrieren und die von ihnen geprägten Diskurse zu analysieren, bildet eine wichtige Brücke zwischen Literaturwissenschaft und Geschichtswissenschaft“, so Prof. Dr. Wolfram Pyta. Ein Kernelement des Projekts sind drei Lernveranstaltungen, die am Semesterende zu einem interdisziplinären Workshop zusammengeführt werden. So werden Studierende zum interdisziplinären Brückenschlag angeleitet und zugleich für die Relevanz des Konzepts „Wehrhafte Demokratie“ in Vergangenheit und Gegenwart sensibilisiert.
Ein zentraler Aspekt ist der Dialog mit der breiten Öffentlichkeit. „Unser Projekt adressiert neben interessierten Bürgerinnen und Bürgern zum einen gezielt das Segment der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, zum anderen die Gruppe der politischen Entscheidungsträger“, so Prof. Dr. Pyta, der Initiator des Projekts. Zu den wichtigen Bausteinen gehört daher auch eine Kooperation mit dem Jugendhaus Mitte. "Wir freuen uns sehr, dass die Universität den Transfer in die Gesellschaft sucht", so Pia Preu, die Leiterin der Einrichtung "Lernort Geschichte". Ein weiteres Kernelement wird neben einer Reihe von Veranstaltungen auch die Produktion von podcasts und social-media-Aktivitäten darstellen.
Veranstalter:
Das Projekt "Demokratische Gesellschaft und totalitäre Herausforderung" wird von Prof. Dr. Wolfram Pyta geleitet und in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Torsten Hoffmann und Prof. Dr. Felix Heidenreich durchgeführt. Die Förderung durch die Universität Stuttgart erfolgt als Wissenstransferprojekt.
Vom 6. bis 9. November findet in Stuttgart das von Yeama Bangali kuratierte Festival „Pop-up-Werkstatt Schwarze deutsche literarische Perspektiven“ statt mit vielen beeindruckenden Autorinnen (https://www.popupwerkstatt.de/veranstaltungen/). Grund genug, unser Doktorand*innenkolloquium auf diesen Zeitraum zu legen, damit alle Teilnehmer*innen auch an den Veranstaltungen am Freitagabend und am Samstag teilnehmen können.
Ausgehend von den Perspektiven des Festivals lädt das Kolloquium zu Vorträgen über postmigrantische, transnationale und dekoloniale Genderperspektiven innerhalb der deutschsprachigen Literatur ein. Die Vorträge sollen einen Einblick in das jeweilige Promotionsprojekt geben und dazu von einem spezifischen Beispiel des Textkorpus ausgehen. Pro Vortragender sind 40 Minuten vorgesehen (20 Min. Vortrag, 20 Min. Diskussion).
Interessierte schicken bitte bis zum 30.10. ein Abstract von 300 Wörtern an Annette Bühler-Dietrich und Sylvia Schlettwein: annette.buehler-dietrich@ilw.uni-stuttgart.de, sschlettwein@unam.na.
Für eine Teilnahme am Kolloquium ist es notwendig, Mitglied zu sein. Der Beitrag für Studierende beträgt 10€, für Teilzeitbeschäftigte 20€, für Vollbeschäftigte 30€ (www.fridelev.de)
m 18. Jahrhundert wandeln sich Begriff und Einsatz dessen, was in der Antike techne hieß und handwerkliche Arbeitstechniken bezeichnete. Wissensgebieten differenzieren sich aus und mit der zunehmenden Profilierung von Kunst als eigenständigem Funktionssystem mit eigenen Regeln, das sich dezidiert von anderen abgrenzt, wird die alte Koppelung von Kunst und Handwerk, die im techne-Begriff steckt, neu reflektiert. Zugleich legen neue Techniken ein verändertes Justieren der Zusammenhänge von Kunst und Technik nahe. Die Tagung möchte diesen Konstellationen und Konfliktfeldern aus interdisziplinärer Perspektive nachgehen, neben den handwerklichen und maschinellen Techniken auch exemplarische ‚Alltagstechniken‘ des 18. Jahrhunderts – des Malens, Lesens, Schreibens, Klavierspielens usw. – näher beleuchten. Ein besonderer Schwerpunkt soll dabei auf den historischen Sammeltechniken liegen. Darüber hinaus gilt es, die technischen Möglichkeiten zur Erforschung des 18. Jahrhunderts in den Blick zu nehmen und somit eine Schnittstelle zu den Digital Humanities zu eröffnen.
Veranstalterinnen:
PD Dr. Kristin Eichhorn, Universität Stuttgart
Prof. Dr. Sandra Richter, Deutsches Literaturarchiv Marbach
Kontakt:
Dr. Madeleine Brook, madeleine.brook@dla-marbach.de
Anmeldung: Birgit Wollgarten, forschung@dla-marbach.de
Die Schriftstellerin Gerlind Reinshagen hat Hörspiele, Theaterstücke, Romane und Lyrik publiziert, wurde vom Suhrkamp Verlag verlegt und auf allen großen Bühnen gespielt – und ist heute doch sowohl auf dem Theater als auch in der Literaturwissenschaft unterrepräsentiert. Reinshagen etablierte sich in den späten 60er- und 70er-Jahren mit einem eigenen Theaterstil, der Theatertendenzen ihrer Zeit aufgriff und doch einzigartig blieb. Trotz ihrer Präsenz in den 70er- und 80er-Jahren und ihres kontinuierlichen dramatischen Schaffens setzte sich ihr Erfolg in den 90er-Jahren nicht in gleicher Weise fort – ein Aspekt, der die Frage verdient, wie hier möglicherweise generationelle Ungleichzeitigkeiten oder auch ein schnelllebiger Theaterbetrieb eine größere Sichtbarkeit verhinderten. Diese Tagung zu Reinshagens Werk soll alle Gattungen der Autorin, besonders aber ihre Theaterstücke, beleuchten. Reinshagens Auseinandersetzung mit der Arbeitswelt, mit Geschlechterkonstruktionen, Krankheit, Geschichte, Dystopie und Intertextualität bietet vielfältige Anknüpfungspunkte für eine Neulektüre des Werks heute.
Im Rahmen der Reihe #LiteraturBewegt, gefördert von der Kulturstiftung des Bundes und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Weitere Förderung aus den Mitteln des SRCTS – Stuttgart Research Center for Text Studies und des Diversity Fonds der Universität Stuttgart. In Zusammenarbeit mit dem Medienarchiv der Universität Stuttgart.
Konzept
Annette Bühler-Dietrich, Uni Stuttgart
Claus Zittel, SRCTS Stuttgart
Kontakt / Anmeldung
Dr. Madeleine Brook – Forschungsreferat DLA Marbach
Sekretariat: Birgit Wollgarten – Tel.: 07144 - 848 - 175 – E-Mail: forschung@dla-marbach.de
Literaturpolitische Aktivitäten gehören für die Neue Rechte im 21. Jahrhundert zu den zentralen Betätigungsfeldern und haben in Bezug auf Umfang, Formate, Komplexität und Breitenwirkung an Relevanz gewonnen. Bedeutsam sind sie im Kontext einer kulturorientierten Metapolitik, die auf eine schleichende Verschiebung des kulturellen Diskurses abzielt.
Im Rahmen dieser Tagung, bei der es sich um die erste Veranstaltung des an der Universität Stuttgart angesiedelten DFG-Projekts ‚Neurechte Literaturpolitik‘ handelt, werden die literaturbezogenen Aktivitäten der Neuen Rechten hinsichtlich ihrer kulturpolitischen, literaturbetrieblichen und philologischen Implikationen analysiert und eingeordnet. Ziel der Tagung ist es, neurechte Literatur und Literaturpolitik einerseits auf ihre ästhetischen Verfahren und Traditionen zu befragen, sie andererseits im Kontext der aktuellen Literaturbetriebsforschung in den Blick zu nehmen.
Anmeldung: Die Teilnahme ist nach Anmeldung bis zum 18.1.2024 bei Katja Klumpp (katja.klumpp@ilw.uni-stuttgart.de) möglich.
Veranstaltungsort: Evang. Bildungszentrum Hospitalhof Stuttgart | Salon, Büchsenstraße 33, 70174 Stuttgart, www.hospitalhof.de
Konzept und Organisation:
Prof. Dr. Torsten Hoffmann (Universität Stuttgart)
Dr. Nicolai Busch (Universität Mannheim)
Dr. Kevin Kempke (Universität Stuttgart)
Eine Veranstaltung im Rahmen des von der DFG geförderten Forschungsprojekts ‚Neurechte Literaturpolitik‘ an der Universität Stuttgart.
Forschungsprojekte
Am 1. Mai 2025 starten Kristin Eichhorn und Toni Bernhart ihren Podcast "Wiederanders".
Johannes R. Becher (1891–1958) ist bekannt als Dichter der Hymne der DDR und als deren erster Kulturminister. Doch sein Leben war sehr viel abenteuerlicher, als dieser vermeintliche Zielpunkt erahnen lässt. Er war Expressionist und Sprachzertrümmerer par excellence, verfasste Poetiken, galt als Repräsentant des Sozialistischen Realismus und schrieb spätromantische Lieder. Mit fast allen, die in Kunst und Literatur, später auch in der Politik Rang und Namen hatten, stand er in Verbindung und überlebte drei Suizidversuche. Seine Spuren führen, ausgehend von der Münchner Bohème der Zeit der Klassischen Moderne, nach Paris, Wien, Prag und Moskau und ebenso nach Jena, Bad Saarow oder Bad Urach.
Bechers Geschichte ist ein wilder Ritt durch die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, kompliziert, verworren und verwoben mit der deutsch-deutsch-deutschen Geschichte. Davon wird dieser Podcast erzählen und Fragen stellen, die heute relevanter denn je erscheinen: Was verbindet Ost und West? Was bringt ein politisches System zum Kippen und was kann man dafür oder dagegen tun? Wie politisch soll die Kunst sein und verliert sie dadurch automatisch an Qualität?
Veröffentlicht auf Podigee und überall, wo es Podcasts gibt: https://becher-podcast.podigee.io/
Konzept, Redaktion, Regie, Produktion und Stimmen: PD Dr. Kristin Eichhorn und Apl. Prof. Dr. Toni Bernhart
Mit Unterstützung der Hochschulkommunikation der Universität Stuttgart und in Zusammenarbeit mit HORADS 88,6, dem Campusradio für die Region Stuttgart und Ludwigsburg
Literaturpolitische Aktivitäten der deutschsprachigen Neuen Rechten haben im 21. Jahrhundert in Bezug auf Umfang, mediale Formate, Reflexionsgrad und Breitenwirkung ein neues Niveau erreicht: Neurechte Verlage, Zeitschriften, Bücher, Blogs, Podcasts und Videos publizieren literarische Texte, geben Lektürehinweise, betreiben Literaturkritik und Literaturwissenschaft. Dies alles geschieht vor dem Hintergrund eines metapolitischen Konzepts – man will zunächst die kulturelle Deutungshoheit gewinnen, um damit und danach politische Ziele durchsetzen zu können. Literaturpolitik ist deshalb kein politischer Nebenschauplatz, sondern eines der wichtigsten Aktionsfelder der neurechten Thinktanks.
Die DFG fördert das Projekt vom 1.9.2023 bis zum 31.8.2026.
Projektleitung: Prof. Dr. Torsten Hoffmann
Wissenschaftlicher Mitarbeiter: Alexander Fischer
Studentische Hilfskraft: Sara Öz
Assoziiertes Mitglied: Dr. Kevin Kempke
Das Stuttgarter Medienarchiv ist eine Sammlung von Film- und Tonträgern und von unterschiedlichen Wiedergabegeräten für Film, Bild und Ton. Es wurde um 1970 von den Abteilungen für Neuere deutsche Literatur zu Lehr- und Forschungszwecken angelegt und bis in die 1990er Jahre fortgeführt. Überliefert ist auch der Zettelkatalog, der die Medien erschließt. Für die Forschung ist es heute noch interessant, etwa in fachgeschichtlicher oder mediengeschichtlicher Hinsicht.
Projektleitung: Apl. Prof Dr. Toni Bernhart
Promotionen
Überdurchschnittlich gute Masterstudierende und Studierende mit Abschluss Staatsexamen können gerne bei uns promovieren. Wenn Sie über eine Promotion nachdenken, wenden Sie sich am besten frühzeitig an eine mögliche Betreuungsperson oder an unsere Studiengangsmanagerin, um sich beraten zu lassen.
Literaturwissenschaftliche Promotionen können auch in einem Joint PhD Program der Universität Stuttgart und dem King’s College London geschrieben werden. Studierende können sich bei Interesse an Yvonne Zimmermann wenden. Informationen zum King’s College finden Sie hier.
Folgende Promotionsprojekte entstehen gerade bei uns (Auswahl):